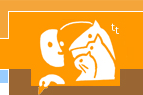
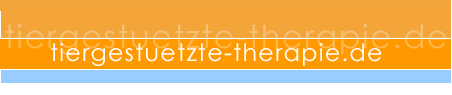
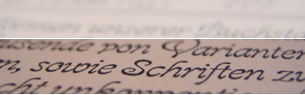

|
|
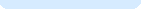 |
| tt-Texte | wissenschaftliche Texte | |
Der folgende Artikel von Gerd Ganser ist erschienen im
Der Artikel beschreibt den Einsatz eines dafür ausgebildeten Hundes in einer tiefenpsychologisch orientierten Kinderpsychotherapie. Hintergrund sind tiefenpsychologische Konzepte (Mentalisierung, Strukturbezogene Psychotherapie, Szenisches Verstehen), mit deren Hilfe wichtige Therapiethemen (Aggression, Libido, Anpassung) in der Arbeit mit dem Kind und einem Therapiehund beschrieben werden.
Zusammenfassung:
Der Einsatz eines Therapiehundes in einer tiefenpsychologischen Kinderpsychotherapie verändert das Setting und eröffnet die Möglichkeit, triangulierende Prozesse zu fördern. Ein Hund kann die Patienten motivieren, für den Therapieprozess öffnen und die Therapie lebendiger werden lassen. Die Reaktionen eines Hundes mit seinen besonderen „Antennen“ verweisen auf frühe, vorsprachliche Erfahrungen, die therapeutisch aufgegriffen werden können. Wichtige Therapiethemen wie Aggression, Libido und Anpassung inszenieren sich durch den Hund konkret erfahrbar im Therapieraum und können durch szenisches Verstehen und Mentalisieren im therapeutischen Prozess bearbeitet werden.
Der Einsatz eines Therapiehundes in der tiefenpsychologischen Kinderpsychotherapie
von Gerd Ganser
Der Artikel beschreibt den Einsatz eines dafür ausgebildeten Hundes in einer tiefenpsychologisch orientierten Kinderpsychotherapie. Tiere, insbesondere Pferde und Hunde, werden in durchaus beachtlichem Umfang in pädagogischen und therapeutischen Feldern eingesetzt. Die Wirkfaktoren der sog. „tiergestützten Interventionen“ sind Ziel einer Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen in therapeutischen und pädagogischen Bereichen, wobei davon ausgegangen wird, dass der Pädagoge bzw. Therapeut (1) das Tier im Rahmen seiner Profession einsetzt.(2) Nicht das Tier macht also die Therapie, sondern der Therapeut mit Hilfe des Tieres, so wie der Kinderpsychotherapeut auch andere Medien in der Therapie nutzt (Puppen, Malen, Sandspiel, etc.). Der Hund ist dabei allerdings kein Mittel wie jedes andere, da er als lebendiges, fühlendes Wesen die gesamte Therapiesituation verändert und Möglichkeiten eröffnet, die anderes „Spielmaterial“ nicht bietet. Der Artikel beleuchtet zwei Fragestellungen: Wie verändert die Anwesenheit eines Hundes die Therapiesituation? Wie kann der Therapeut die Interaktion zwischen Patient und Hund gezielt therapeutisch nutzen?
Thema Anwesenheit des Hundes:
Die Kontaktaufnahme:
Die Eltern berichten häufig, dass es für sie leichter war, ihr Kind für den Gang zum Therapeuten zu motivieren, indem sie ihrem Kind ein Bild meiner Hündin auf meiner Homepage zeigten. Kinder sind i.d.R. sehr an Tierkontakten interessiert und kommen so mit einer deutlich positiveren Erwartungshaltung ins Erstgespräch. Die Anwesenheit des Hundes beim Erstkontakt kann dann z.B. genutzt werden indem der Therapeut etwas vom Hund erzählt, sich für die Erfahrungen des Kindes mit Hunden interessiert und den ersten Kontakt des Kindes mit dem Hund einfühlsam gestaltet. Im Fokus der Aufmerksamkeit steht dann nicht das psychische Symptom, die vielleicht peinlich erlebte Erkrankung oder das „Versagen“ des Kindes, sondern eine interessante, positive Beziehungserfahrung im Hier und Jetzt des therapeutischen Raumes. Dabei kann das Kind auch beobachten wie der Therapeut mit dem Hund umgeht, wie er z.B. die Unsicherheit des Hundes aufgreift, akzeptiert und verbalisiert. Das Kind kann übertragen bzw. hoffen, dass der Therapeut ebenso mit der Unsicherheit und Angst des Kindes, die im Erstkontakt sicherlich da ist, angemessen umgehen wird. Die Anwesenheit des Hundes und die entstandene positive Atmosphäre erleichtern hier das Sprechen über die Schwierigkeiten, wegen denen das Kind zur Therapie kommt. Mit „Anwesenheit“ ist gemeint, dass der Hund präsent ist, einbezogen wird, und eine Möglichkeit zur Beziehungsaufnahme bietet und nicht, dass ein Hund in einer Ecke des Raumes liegt. (3)
Die Eltern des 11 jährigen Benno (Name geändert) wandten sich an den Therapeuten, weil ihr Sohn in der Schule gemobbt wird. Sie berichten: Benno hat es auch ansonsten schwer mit Kontakten zu anderen Kindern und er hat bis heute keinen Freund gefunden, so dass er außerhalb der Schule ausschließlich mit der Schwester und der Mutter bzw. Vater seine Freizeit verbringt. Benno ist sehr ängstlich, was er aber nicht zugibt und mit wortreichen Erklärungen zu verdecken versucht. Eine Schwierigkeit sehen die Eltern darin, dass Benno nicht zu einer Therapie kommen will, weil aus seiner Sicht nicht er selbst verkehrt oder krank ist, sondern die ihn mobbenden Kinder ihr Verhalten verändern müssen – womit er ja auch teilweise recht hat. Die Eltern bestehen aber gegenüber Benno darauf, dass er sich wenigstens einmal den Therapeuten und seinen Hund ansieht. So lerne ich ihn mit seinen Eltern im Erstgespräch kennen.
Benno ist ein schlanker, fast dürrer Junge mit langen blonden Haaren. Auffallend sind neben seinem femininen Äußeren auch seine Bewegungen und seine Körperspannung und Haltung. Er bewegt sich unharmonisch, irgendwie eckig, geht stolpernd mit nach innen gedrehten Füßen. Ich kann mir sofort gut vorstellen, dass er auf dem Schulhof Ziel von Spott und Abwertung ist. Nach der Begrüßung mache ich Benno auf Danka, meine Golden Retriever Hündin, aufmerksam, die auf der anderen Seite des großen Therapieraumes auf ihrer Decke liegt und neugierig herüber schaut. Benno meint, dass er gut mit Hunden klar kommt und auch vor großen Hunden überhaupt keine Angst hat. Ich erzähle etwas von der Geschichte Dankas: Wie sie in Dänemark auf dem Land mit ihren vielen Geschwistern im Rudel groß geworden ist; welche große Angst sie hatte, als sie hier in die Stadt gekommen ist und so viele neue Geräusche, Gerüche und andere Hunde kennen gelernt hat; wie ich Danka dabei begleitet und unterstützt habe, ihre Angst zu überwinden und dass Danka auch heute noch sehr vorsichtig gegenüber Fremden ist. Ich frage Benno, ob er das Begrüßungsspiel mit Danka machen will, um es ihr zu erleichtern, zu uns zu kommen, um ihn kennen zu lernen. Er stimmt zu und so rufen wir Danka und Benno gibt ihr nach einem bestimmten Ritual ein Leckerli. Mir fällt auf, dass Danka noch zurückhaltender als üblich kommt. Sie hält ihren Kopf gesenkt, bewegt sich langsam, vorsichtig, mit hängendem Schwanz und sieht immer wieder zu mir hin. Sie braucht meine mimische Aufforderung, um weiter zu gehen. Benno streichelt Danka dann nur am Hinterkopf und hält einen möglichst großen Abstand zu ihrem Maul, indem er seinen Arm so verdreht, dass die Armhaltung seltsam anmutet. Ein normales Streicheln ist so gar nicht möglich. Entgegen seinen verbalen Behauptungen ist seine Angst offensichtlich. Ich unterhalte mich mit Benno über Dankas Angst vor anderen Hunden und habe den Eindruck, dass wir eigentlich über Bennos Angst sprechen – seine Angst vor dem unbekannten Therapeuten und davor als krank angesehen zu werden, seine Angst vor dem großen Hund , also seine konkrete Angst im Hier und Jetzt der Situation und über seine grundsätzliche Angst, die ihn hier zur Therapie gebracht hat. Er hat viel Verständnis für Dankas Angst und meint, dass sie es auch wirklich schwer hat sich gegen potentielle Angreifer zu wehren, weil sie ja als Therapiehund nicht aggressiv ist und nicht beißen darf – so lautet seine Phantasie und Projektion. Er selber kenne das auch. In der Schule werde er oft von anderen Kindern gemobbt, und weil er nicht zurück schlagen wolle, könne er sich auch nicht wehren…das sei wie bei Danka. Jetzt ist es möglich mit Benno über seine Erfahrungen in der Schule zu sprechen, und wir kommen darüber ins Gespräch, warum er heute hier zur Therapie gekommen ist.
Nach diesem Erstgespräch will Benno auf jeden Fall wieder kommen. Die Anwesenheit und Einbeziehung von Danka hat dazu beigetragen, dass sich Benno entgegen seinen ursprünglichen Befürchtungen auf eine Therapie einlassen konnte und schon im Erstgespräch das wesentliche Thema der Therapie verbalisiert werden konnte, ohne dass sich Benno stigmatisiert, krank oder abgewertet fühlen musste. Die Fallvignette wird weiter unten fortgeführt.
Der „Dritte“ im Raum:
Wenn das Kind den Hund als eigenständiges Subjekt, als „Du“ (Du-Evidenz) wahrnimmt, wird die normalerweise dialogische therapeutische Situation durch die Anwesenheit des Hundes zum Trialog, zur kleinen Gruppe in der es mehrere unterschiedliche Beziehungen gibt und in der der Therapeut oder der Patient den jeweils anderen bei einer Interaktion beobachten kann. Diese Situation eröffnet die Möglichkeit, therapeutische Techniken aus der Gruppenbehandlung einzusetzen (z.B. zirkuläres Fragen). Des Weiteren bietet sich der Hund als Projektionsfläche an. Aggressive wie auch libidinöse Bedürfnisse und Ängste können auf den Hund projiziert werden, ohne die therapeutische Beziehung zu belasten. Wie in einer Gruppentherapie kann der Therapeut vielmehr „neben“ oder „hinter“ dem Patienten stehen und mit ihm zusammen die Projektionen untersuchen. Wäre der „Dritte“ im Raum ein anderer Mensch, müsste man beim Verbalisieren und Agieren der Affekte auf diesen Mitmenschen Rücksicht nehmen. Eine Eigenart der tiergestützten Therapie ist, dass man mit dem Pat. alles besprechen kann ohne, dass der Hund dies versteht und seinerseits auf das Besprochene reagiert oder vor verbalen Projektionen geschützt werden müsste. Ein spezifischer Vorteil ist dabei, dass der Therapeut quasi beliebig von der intimen Zweierbeziehung zur Einbeziehung des „Dritten“ hin und her wechseln kann, indem er den Hund einbezieht oder ihn auf seinen „Platz“ schickt. In der strukturbezogenen Psychotherapie nach Gerd Rudolf (2013) wird betont, wie hilfreich es für strukturell gestörte Patienten (dies gilt sicherlich auch für Kinder) ist, in der Triangulierung zu arbeiten. Dabei ist das Dritte das Verhalten des Patienten von außen gesehen. „Da strukturell gestörte Patienten nur eingeschränkt über einen seelischen Binnenraum verfügen, in dem sie ein schwieriges, widersprüchliches Geschehen reflektieren können (d.h. darüber nachdenken, es aus verschiedenen Perspektiven betrachten und in seinen Gegensätzen abwägen), ist es therapeutisch hilfreich, mit ihnen einen dritten Standpunkt einzuüben, von dem aus sie mit Unterstützung des Therapeuten ihre eigene Situation quasi von außen wahrzunehmen lernen. Das ist eine wichtige Vorübung für die selbstreflexive Wahrnehmung das Patienten“ (Rudolf G. 2013, S. 134). Durch die Anwesenheit des Hundes kann der Therapeut nun relativ elegant diesen dritten Standpunkt einnehmen und das Verhalten des Kindes betrachten und verbalisieren indem er das Geschehen durch die Augen des Hundes sieht („Wenn ich jetzt Danka wäre, würde ich wohl denken, dass Du wütend wärst….“) oder sich laut fragt, wie der Hund die Situation wohl erlebt. Gerade für Kinder ist diese Frage leichter nachzuvollziehen als wenn man eine hypothetisch dritte Position einnimmt.
Lebendigkeit und Motivation:
Im Vergleich zu Therapien ohne Hund fällt besonders auf, dass die Anwesenheit des Hundes die Atmosphäre in Richtung von mehr Lebendigkeit und Freude verändert. Der Hund hat offensichtlich eine stärker auffordernde, animierende Wirkung als das normalerweise zur Verfügung stehende Spielmaterial. Auch schüchterne, zurückhaltende Kinder kommen so leichter in Aktion und fangen an zu spielen und sich im Therapieraum zu bewegen. Interessanterweise werden auf der anderen Seite überbordende, destruktive Aktionen, z.B. von ADHS Kindern, durch die Anwesenheit des Hundes gemildert bzw. beschränkt. Diesen ausgleichenden Effekt beschreiben auch Kotrschal und Ortbauer (2003) in ihrer Studie über das Sozialverhalten von Grundschülern, in deren Klasse ein Hund eingesetzt wurde. Folgender therapeutischer Wirkfaktor ist ausschließlich in tiergestützten Interventionen möglich: Das Kind kann (bei einer entsprechenden Beziehung) den Hund tatsächlich streicheln (nicht nur symbolisch im Rollenspiel) und damit auch real libidinöse Bedürfnisse ausdrücken und leben und dadurch auf anschauliche, greifbare Weise in die Therapie einbringen. Gerade für Kinder ist der körperliche Ausdruck von Gefühlen essenziell, kann aber normalerweise in Therapien nur symbolisch ausgedrückt werden. Verschiedene Untersuchungen legen nahe, dass beim Streicheln eines Hundes auch physiologische Vorgänge ausgelöst werden, die z.B. den Blutdruck senken und Entspannung/Entängstigung induzieren (s. Wohlfahrt, et.al.2013). Es ist naheliegend und entspricht meiner Erfahrung, dass man schwierige Themen leichter besprechen kann, während das Kind den Hund streichelt. Die Verhaltenstherapie würde wohl von einem angstmindernden Reiz während der verbalen Konfrontation sprechen. Die Therapie kann für das Kind lebendiger, interessanter und leichter werden, wodurch sich die Motivation für die Therapie insgesamt verbessert und mögliche Widerstände aus zu großer Angst oder Scham gemildert werden können.
Thema Interaktion:
Hund bleibt Hund:
Bisher wurde in diesem Artikel einfach vom „dafür ausgebildeten“ Hund gesprochen. Dies soll nun näher erklärt und auch gegenüber den allgemein üblichen Ausbildungen für Therapie- und Begleithunde abgegrenzt werden. Im Unterschied zu der hier gemeinten Ausbildung eines Hundes für tiefenpsychologische Psychotherapie wird in den anderen Ausbildungen z.B. zum Begleithund vorrangig das Ziel verfolgt, dass der Hund die Befehle des Hundehalters befolgt und ein bestimmtes Verhalten erlernt. So lernt z.B. ein Hund, der im Altersheim Menschen besuchen soll, dass er jede Kontaktaufnahme akzeptiert und dabei auch ungeschickte Bewegungen duldet. Ein Hund im Kindergarten soll die enorme Lautstärke und die ungebremsten Liebesbekundungen von Kindern aushalten. Bei diesen Aufgabenstellungen muss der Hund gegebenenfalls seine eigenen ursprünglichen Impulse unterdrücken. Wenn ich in diesem Artikel vom „ausgebildeten Therapiehund“ spreche, ist demgegenüber ein Hund gemeint, der sein Befinden ausdrücken kann und auch darf. Er ist nicht auf ein bestimmtes Verhalten beschränkt oder auf spezielle Kunststücke trainiert. Gerade die unverstellten, natürlichen Impulse des Hundes werden als wertvolle Informationen für den Therapieprozess betrachtet und einbezogen. Grundsätzlich darf der Hund zeigen, was er mag oder nicht mag. Er darf zum Kind kommen oder auch gehen, er darf Lust auf Spielen haben oder auch nicht usw. Im Zentrum der Ausbildung zum Therapiehund steht nach diesem Verständnis die Kommunikation, das gegenseitige Verstehen von Mensch und Hund. Dieses Ausbildungskonzept wurde von der heute in Dänemark lebenden deutschen analytischen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Margarete Weiler entwickelt, die seit vielen Jahren Hunde züchtet,(4) und Mensch-Hunde-Teams ausbildet (s. www.wikkegaard.de). Der Hund lernt in dieser Ausbildung die Wünsche „seines“ Menschen zu erkennen, so dass der Hund darauf reagieren kann. Besonders geeignet sind Hunde mit einem ausgeprägten „will to please“, dem Bedürfnis und der Freude daran, „seinem“ Menschen zu gefallen. Da es nicht um „Gehorchen“ geht, sondern um eine Kontrollierbarkeit, die aus der Beziehung heraus erwächst, tauchen im Training die ansonsten oft schwierigen „Dominanzfragen“ kaum auf.(5) Genauso wichtig wie die Ausbildung des Hundes ist in diesem Konzept die Ausbildung des Menschen, damit dieser die Signale und Bedürfnisse des Hundes „lesen“ lernt. Nur dann kann er dem Hund vermitteln, dass er ihn versteht und angemessen auf ihn reagieren. Wenn der Hund erlebt, dass auf seine Signale eingegangen wird, wird er diese auch weiterhin zeigen, weil er sie als wirksam erlebt hat. Unwirksames Verhalten wird von Hunden relativ schnell verlernt. In der Ausbildung entsteht ein Mensch-Hund-Team, das sich aufeinander bezieht, aufeinander achtet und miteinander kommuniziert. So ausgebildet, kann sich der Hund frei im Therapieraum bewegen, den Kontakt zu den Pat. gestalten und dem Therapeuten Rückmeldungen geben, wie sie eben nur ein Hund geben kann. Der Therapeut wiederum kann die Rückmeldungen des Hundes lesen, sie für die Therapie nutzen und darauf achten, dass der Hund Freude am Tun hat und nicht in Stress gerät.
Mentalisieren:
In der hier beschriebenen hundegestützten Therapie werden keine speziellen Übungen mit dem Hund gemacht, vielmehr werden die entstehenden Interaktionen zwischen Kind und Hund mentalisierend aufgegriffen. Das Mentalisierungskonzept wurde von der Arbeitsgruppe um den Psychoanalytiker Fonagy (s. Allen, Fonagy, Bateman, 2011) entwickelt und führt aus, dass alle (analytisch-tiefenpsychologischen) Psychotherapien mentalisieren, d.h. die Gefühle und Gedanken des Pat. erforschen, aber auch die Gefühle und Gedanken von den Anderen zu verstehen versuchen. Das Innere des Pat. und die Interaktionen mit anderen Menschen werden mental erfasst, sie bekommen Worte, Symbolisierungen, werden bewusst und ausdrückbar.
Was auch immer im Therapieraum passiert kann mentalisiert werden. Die Begegnungen mit dem Hund bieten eine Reihe von Erfahrungen, die ohne Hund so nicht möglich wären z.B. Füttern, Streicheln, Spiele/Kunststücke beibringen, Befehle erteilen usw. Sie bereichern den „Stoff“, das „Material“ mit dem gearbeitet werden kann. Als Kindertherapeut kennt man die Schwierigkeit, dass manche Kinder ihr Erleben sprachlich nicht differenzieren können und alles entweder „cool“ oder „blöd“ finden. Therapieziel wäre dann in diesen Fällen zunächst die Differenzierung und Erweiterung der mentalen Fähigkeiten. Der Hund bietet die Möglichkeit, dass der Therapeut laut überlegt, wie es dem Hund wohl gerade geht und wie es dem Pat. vermutlich geht. Er kann dem inneren Erleben des Pat. und dem Geschehen im Raum dort Sprache und Symbole geben, wo der Pat. seine Ausdrucksfähigkeit noch nicht entwickelt hat. Im Sinne von Rudolf kann er „dem Patienten voran gehen“. Fonagy et.al. sagen „Mentalisieren erzeugt Mentalisieren“. Nach meiner Erfahrung ist es für Kinder nahe liegend und interessant, sich über den Hund und die Interaktionen Gedanken zu machen, und das erfolgreiche Mentalisieren zeigt einen sofortigen, sichtbaren, spürbaren, erlebbaren Erfolg, indem der Hund dann z.B. den klar geäußerten Befehl des Kindes „Sitz“ zu machen, auch ausführt. Das sofortige, unmittelbare Feedback darüber, ob der Therapeut und das Kind beim gemeinsamen Verstehen richtig lagen, ist motivierend für weiteres Mentalisieren.
Szenisches Verstehen:
Mehr noch als in der Therapie mit Erwachsenen, ist man als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut darauf angewiesen, das Handeln des Patienten, die Inszenierung im therapeutischen Raum, die Szene zu beachten und zu verstehen, weil die Sprache bzw. Mentalisierungsfähigkeit (noch) nicht ausreichend vorhanden ist. Deshalb rückt das Spiel des Kindes, seine Art und Weise die Interaktion zu gestalten, in den Fokus der therapeutischen Arbeit. Auch wenn der Therapeut teilweise nonverbale Antworten im Spiel geben kann, ist das Versprachlichen des Geschehens essentiell. Eine bekannte und oft eingesetzte therapeutische Technik ist, z.B. ein Kuscheltier zum Kommentator der Szene zu machen. Bei eher älteren Kindern kann es auch ein imaginärer Reporter oder Fernsehjournalist sein. Der Therapeut wendet sich dann an diesen imaginativen „Dritten“ und erklärt ihm die Situation bzw. schlüpft in die Rolle z.B. des Journalisten und „spielt“ die live-Übertragung des Ereignisses. Dadurch kann der Therapeut die unausgesprochenen Gefühle, Befindlichkeiten, Wünsche etc. in Worte fassen. Kinder können diese Verbalisierungen häufig leichter akzeptieren als direkte Deutungen oder Fragen, und ggf. bestätigen, ergänzen oder korrigieren sie die Annahmen, indem sie dem Kuscheltier oder dem Reporter ihre Sicht weiter erklären. Manche Kinder akzeptieren die erfundenen „Dritten“ allerdings nicht. Nach meiner Erfahrung akzeptieren es aber sogar ältere Kinder und Jugendliche, wenn ich den Therapiehund im o.g. Sinn einsetze und die im Raum vorhandene Szene mit den Gefühlen und Bedeutungen erkläre und dadurch mentalisiere.
Der 6 jährige Jonas (Name geändert) schmeißt wütend das Mensch-ärgere-dich-nicht Brett vom Tisch, schreit „gemein!“ und sitzt mit verschränkten Armen, zusammen gepresstem Lippen und hochrotem Kopf am Spieltisch. Eine direkte Versprachlichung des Therapeuten, wie z.B. „Du bist jetzt wohl wirklich wütend, weil Du verloren hast.“ kann eher Widerstand und Trotz hervorrufen. Aufgrund des Lärmes kam meine Hündin zu uns herüber gelaufen, und ich konnte Danka erklären, dass Jonas gerade sehr wütend ist und dass dies bei Menschen passieren kann, wenn sie ein Spiel verlieren. Das ist ja gar nicht so, beschwert sich Jonas. Er sei so sauer, weil er es nie richtig mache und immer versage, und außerdem sei es jetzt hier genau wie zu Hause, wo immer sein älterer Bruder gewinnt. Natürlich freue ich mich über die „Korrektur“ meines „falschen“ Verständnisses. In dieser Situation war es sehr hilfreich, dass ich Danka diese Szene erklären konnte und nicht einen „Dritten“ zuerst „erfinden“ musste. Diese Intervention hat eine Reihe von Optionen eröffnet, über sein „ständiges Scheitern“ oder auch über seinen Bruder zu sprechen. Dass Danka dann zu Jonas ging und sich den Kopf streicheln lies, entspannte die Situation zusätzlich.
Therapiethemen:
- Aggression: Der Raubtiercharakter des Hundes, die Möglichkeit zu beißen, erfordert eine Stellungnahme, eine Antwort auf die potentielle Gefahr. Die Reaktionen der Kinder reichen von ängstlichen Gefühlen über Ignoranz bis zu Allmachtsphantasien. Entsprechende Bewältigungsmechanismen(z.B. mit Futter locken, mit Befehl kontrollieren, etc.) werden sichtbar.
- Libido: Der Hund fordert offen Zuwendung, Streicheln und versorgt zu werden. Für manche Kinder ist dies ein Beweis, dass der Hund sie mag; manche können sich nicht gegen die Aufforderung des Hundes wehren, manche wollen unendlich versorgen, streicheln, und manche müssen sich verweigern, enttäuschen, ignorieren usw. Positive Gefühle zur Therapie oder zum Therapeuten sind leichter aus zu drücken, da sie auf den Hund übertragen werden können. Eine 17 jährige Pat. kam z.B. zur 2. Therapiestunde mit den Worten: „Ich habe mich ja so gefreut Dich (also Danka) wieder zu sehen.“
- Erziehung/Anpassung: Kinder sind selber Ziel von Erziehung. Auch Hunde werden erzogen, oft sogar dressiert, konditioniert und trainiert. Im Kontakt mit dem Hund eröffnen sich ganz natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten diese Themen anzusprechen und zu bearbeiten. Manche Kinder haben erfahren, dass das Ziel ihrer Erziehung die Anpassung und Unterwerfung ist; manche Kinder erleben Erziehung als positive Aufmerksamkeit; Erziehung kann selbstverständlich sein oder eine bittere Zumutung etc. Was Kinder über Erziehung denken und erleben offenbart sich im Hundekontakt i.d.R. sehr schnell und kann dann mentalisiert werden. Es fällt dem Kind meiner Erfahrung nach viel leichter darüber zunächst in Bezug auf den Hund zu reden als in Bezug auf die Eltern oder gar den Therapeuten. Nach der Frage „Muss denn der Hund kommen, wenn Du ihn rufst?“ fällt die Überleitung zu „Möchtest du denn immer machen, was Deine Eltern von dir wollen?“ leichter. Wie auch immer die Antwort ausfällt, ist das Thema zur Sprache gebracht.
Diese Themen sind in jeder Therapie präsent und zu bearbeiten, wobei die Interaktion mit dem Hund einige Themen leichter zur Sprache bringen lässt und bestimmte Aspekte anstoßen kann. In der Therapie mit Hund sind diese Themen außerdem nicht nur symbolisch im Raum, z.B. durch das Erzählen, Malen, Rollenspiel, sondern ganz real in der gegenwärtigen Situation mit realen Reaktionen des „Dritten“. Diese reale gegenwärtige Beziehung ist ansonsten nur in der Übertragungsbeziehung zum Therapeuten präsent und wird ja auch in den Therapien bearbeitet. Mit dem Hund ist eine weitere Beziehung im Therapieraum, in der die Themen ebenfalls und manchmal auch leichter bearbeitet werden können.
Implizites Unbewusstes/Stimmung:
Der Psychoanalytiker Christopher Bollas (2005) fordert die Therapeuten auf, mehr auf die nonverbalen Verhaltensweisen, auf die vom Pat. erzeugte Atmosphäre/Stimmung zu achten, weil diese auf die frühen Lebenserfahrungen weisen. Diese tiefen, wortlosen aber strukturbildenden Beziehungserfahrungen (lt. Bollas das „ungedachte Bekannte") sind Grundlage für spätere psychodynamische Konflikte und den Aufbau der Persönlichkeit (s. auch Rudolf (2013), S.132 ff). Die frühen Erfahrungen sind zwar unbewusst, aber im Körper gespeichert, präsent, verleiblicht. Sie sind „embodied“ (s. Leuzinger-Bohleber, Emde, Pfeifer, 2013). Ein Hund kann dem Therapeuten helfen, diese nonverbalen, noch ungedachten und nicht-symbolisierten Haltungen und Stimmungen des Pat. zu bemerken. Der Hund reagiert auf die Energie, die Atmosphäre, die nonverbale Haltung, die embodied Person des Pat. und nicht auf die oftmals im Vordergrund stehenden verbalen Aussagen des Kindes. So reagiert meine Hündin z.B. auf laute, impulsive, an ADHS erkrankte Jungen mal ängstlich und mal total entspannt. Bei ängstlichen, schüchternen Patienten verhält sich meine Hündin manchmal unterstützend, pflegend und leckt z.B. den Handrücken des Kindes, aber manchmal warnt sie mich auch durch ein leises Knurren als ob sie sagen würde, dass dieses Kind „gefährlich“ ist, z.B. bei massiv unterdrückten Aggressionen. Oft sind diese Reaktionen des Hundes am Beginn der Therapie nicht zu verstehen, sondern erst im Verlauf der Therapie wird deutlich, was der Hund spontan erfasst. Dabei muss man berücksichtigen, dass der Hund uns Menschen in bestimmten Bereichen sensorisch weit überlegen ist. Die Reaktion des Hundes kann dem Therapeuten so Hinweise geben auf gut versteckte, frühe, basale Strukturen und Konflikte. Allerdings kann der Hund nur auf etwas aufmerksam machen. So wie es keine direkte 1:1 Übersetzung von Traumsymbolen gibt, so kann man auch nicht die Reaktion des Hundes einfach linear als Übersetzung verstehen. Es ist die Aufgabe des Therapeuten, sich von der Reaktion irritieren und anregen zu lassen, Fragen zu stellen und einen sprachlichen Ausdruck zu finden.
Benno hatte sich auf eine Psychotherapie eingelassen und kam einmal in der Woche in meine Praxis. Schon schnell wurde auch Danka für ihn sehr wichtig, und er brachte ihr immer Leckerlis mit. Benno wollte in jeder Stunde zuerst etwas mit Danka machen. Wir versteckten z.B. Leckerli, die Danka suchen musste, ließen sie einen Ball apportieren oder auffangen, ließen sie Sitz und Platz machen, legten Leckerli auf ihre Pfoten, die sie aber erst fressen durfte nachdem wir „frei“ gesagt hatten, und ähnliche Spiele. Obwohl wir scheinbar harmlose Spiele machten, war ich innerlich angespannt und in Hab-acht Stellung. Auch Danka war nicht so locker wie sonst, hatte scheinbar keine echte Freude beim Spielen und folgte nur widerwillig den Befehlen von Benno. Diese merkwürdige Atmosphäre/Stimmung im Raum war nur beim Spiel mit Danka sicht- und spürbar. Wenn Benno eines der anderen Therapiematerialien nutzte, war die Stimmung zwischen mir und Benno entspannt, und er konnte mich mit seiner netten Art und seinen verbalen Äußerungen für sich gewinnen. Im Spiel mit Danka stolperte er dann einmal ungeschickt auf Danka zu, so dass diese sich erschreckte und bellte. Benno erschrak zutiefst und flüchtete sofort zu mir. Er hatte Angst, große Angst und auf einmal, und zum ersten Mal kann er dies auch sagen. Er erzählte, wie viel Angst er morgens hat in die Schule zu gehen, er erzählte von einer Situation, in der er als 3-Jähriger etwas Mutiges tun wollte und seine Mutter ihn abhielt, dass die Mutter Kopfschmerzen bekommt, wenn er laut ist und dass er eigentlich Angst vor Hunden und auch vor Danka hat. Es war wie eine große Befreiung und Erleichterung. Die Atmosphäre im Raum hatte sich total geändert. Die immer schon vorhandene, im Hintergrund gespürte aber verleugnete Angst war verbalisiert. Für die Therapie war dies ein entscheidender Punkt und das Thema Angst konnte nun offen besprochen werden, anstatt im Hintergrund die Atmosphäre zu bestimmen. Auch der Kontakt mit Danka veränderte sich allmählich und wir konnten an seinem nonverbalen Auftreten arbeiten. Wir entdeckten, dass Danka die Befehle von ihm mal ausführte und mal nicht und dass dies davon abhing, wie er sich innerlich zu Danka ausrichtete. Jetzt konnte auch besprochen werden, wie er sich auf seine Mitschüler ausrichtete und welche Rolle dabei die verleugnete Angst spielte. Dies war für den Patienten aber auch für mich eine interessante Arbeit und die untergründige Spannung wich einer entspannten, neugierigen Atmosphäre. Benno und Danka kamen sich mit der Zeit näher, und weil die alles blockierende Angst gelockert war, konnten neue Themenfelder erscheinen. Benno traute sich mehr und mehr Danka auch zu streicheln und liebevolle zärtliche Gefühle zu zulassen. Parallel zur Veränderung in der Therapie, entwickelten sich auch die schulische und die Freizeitsituation positiv. Damit die Entwicklung so positiv verlaufen konnte, war neben der therapeutischen Arbeit mit dem Kind die Arbeit mit den Eltern wichtig. So konnte der Vater für eine intensivere Beziehungsgestaltung mit Benno gewonnen werden, die Mutter konnte von Schuldgefühlen entlastet werden und in der Schule wurde eine Beratungslehrerin eingeschaltet. Trotz dieser ebenfalls wichtigen flankierenden Maßnahmen, war die Befreiung und Bewusstwerdung der Angst ein notwendiger Schritt, der durch den Einsatz des Therapiehundes möglich wurde. Sicherlich hätte man die abgewehrte Angst auch z.B. im Rollenspiel oder der Übertragungsbeziehung entdecken und bearbeiten können, aber wenigstens in diesem Fall war es doch sehr hilfreich, Danka mit ihren tierischen „Antennen“ und ihren unmittelbaren, lebendigen Reaktionen im Raum zu haben.
Fazit/Ausblick:
Die Anwesenheit eines Hundes kann die Motivation des Kindes für die Therapie verbessern, blockierende/hemmende Gefühle schneller abbauen, den Therapieprozess unterstützen und die Lebendigkeit in der Therapiestunde erhöhen. Durch den "Dritten" im Raum eröffnen sich zusätzliche therapeutische Möglichkeiten. Einige wichtige therapeutische Themen können durch die Interaktion mit dem Hund mentalisierend aufgegriffen werden. Die Reaktionen des Hundes verweisen auf nonverbale frühe Strukturen, die vom Therapeuten bemerkt und mentalisiert werden können.
Die Kinderpsychotherapie mit einem Hund ist nicht auf eine bestimmte Richtung oder therapeutische Schule beschränkt. Die Art und Weise wie der Therapeut die Hund-Kind Interaktion aufgreift, wie er sie versteht, deutet und mentalisiert, ist nicht vorgegeben. Der Analytiker wird vielleicht die Reaktion des Pat. auf den Hund so verstehen, dass der Pat. in der Übertragung eigentlich den Therapeuten meint, wenn er den Hund streichelt oder zu kontrollieren versucht. Der Tiefenpsychologe sieht vielleicht die Kompensation des eigenen Bedürfnisses im Streicheln des Hundes. Der Verhaltenstherapeut sieht z.B. die mangelnde Selbstwirksamkeit. Wichtig ist nicht die therapeutische Orientierung des Therapeuten, sondern die fundierte Ausbildung einerseits des Hundes und andererseits des Therapeuten in der Führung des Hundes und im Verstehen des Hundes sowie der Interaktion zwischen Kind und Hund. So muss z.B. sicher gestellt sein, dass die Bedürfnisse des Hundes angemessen berücksichtigt werden (u.a. das Erkennen von Stressanzeichen) damit insbesondere Beißunfälle mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden können. Die Ausführungen wollen zeigen, dass der Einsatz eines Hundes in der Kinderpsychotherapie faszinierende Möglichkeiten eröffnet, wenn der Hund fachlich fundiert und gezielt eingesetzt wird.
Persönliche Anmerkung:
Ich möchte noch anmerken, dass sich nicht nur für die Patienten, sondern auch für mich die Arbeitssituation durch Dankas Mitwirkung geändert hat. Die vielen Stunden, die ich vorher alleine in der Praxis verbracht habe sind wesentlich interessanter und lebendiger geworden und ich habe immer eine „Freundin“ an meiner Seite, mit der ich zusammen die oft schwierigen Begegnungen teile. Wenn mich Danka dann auch noch „zwingt“ regelmäßig mit ihr Gassi zu gehen, Luft zu holen, Natur zu erleben und andere Hundehalter zu treffen, dann ist auch dies ein Beitrag zur notwendigen aber oft vernachlässigten eigenen Psychohygiene. Selbstverständlich sind die positiven Wirkungen auf die Therapie und den Therapeuten nur möglich, wenn der Therapeut auch privat einen Hund halten will, da die Anschaffung eines Hundes das gesamte Leben auch außerhalb der Arbeit beeinflusst. Wenn man aber einen Hund will oder schon hat, dann möchte ich Mut machen, den Hund bei charakterlicher Eignung und nach entsprechender gemeinsamer Ausbildung auch in der Therapie einzusetzen.
Anmerkungen:
1. Um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten benutze ich durchgehend die männliche Form für „Therapeut“ und „Patient“, weil ich beim Therapeut an mich selber denke und überwiegend männliche Patienten behandle. Ich hoffe, dass sich Therapeutinnen und Patientinnen dadurch nicht diskriminiert fühlen.
2. Eine kritische Zusammenschau des aktuellen Forschungstandes findet sich bei Wohlfahrt, Mutschler, Bitzer (2013)
3. Vgl. Prothmann (2008). Die hier beschriebene Einbeziehung des Hundes unterscheidet sich allerdings wesentlich von dem Vorgehen bei Prothmann.
4. Ziel der Zuchtlinie sind Eigenschaften und Wesensmerkmale, die sich positiv auf die Eignung zur Therapiehundeausbildung auswirken.
5. Für die Eignung des Hundes spielen einige Faktoren eine Rolle (Rasse, der Charakter der Elterntiere, frühe Aufzucht und Sozialisation, Bindungsfähigkeit etc.) die hier nicht näher erläutert werden können.
Literatur:
Allen, J. & Fonagy, P. &Bateman, W. (2011).Mentalisieren in der psychotherapeutischen Praxis. Stuttgart: Klett-Cotta
Bollas, C. (2005). Der Schatten des Objekts. (2. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta
Kotrschal, K. & Ortbauer, B. (2003).Kurzzeiteinflüsse von Hunden auf das Sozialverhalten von Grundschülern. In Olbrich, E. & Otterstedt, C., (Hrsg.) Menschen brauchen Tiere (S. 267 – 272). Stuttgart: Franckh-Kosmos
Leuzinger-Bohleber, M. & Emde R. & Pfeifer R. (Hrsg.). (2013). Embodiment. Ein innovatives Konzept für Entwicklungsforschung und Psychoanalyse. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
Prothmann, A. (2008). Tiergestützte Kinderpsychotherapie (2., ergänzte Auflage). Frankfurt a.M.: Peter Lang Verlag
Rudolf, G. (2013). Strukturbezogene Psychotherapie (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: Schattauer
Wohlfahrt, R., Mutschler, B. Bitzer E.,(2013). Wirkmechanismen tiergestützte Therapie. FITT-Forschungsbericht, Freiburger Institut für Tiergestützte Therapie, online verfügbar unter: http://www.tiere-begleiten-leben.de/fileadmin/medien/tiere-begleiten-leben/Forschung/Forschungbericht_4_Wirkmechanismend_Tgt.pdf [14.12.2013]
Gerd Ganser arbeitet als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut in eigener Praxis. Er ist Ausbilder und Supervisor am deutschsprachigen Institut Wikkegaard – tiergestützte Therapie und Pädagogik in Dänemark, www.wikkegaard.de.
Kontakt: Praxis Gerd Ganser, Ebertplatz 8, 78467 Konstanz, Homepage: www.praxis-ganser.de; Email: praxis.ganser@t-online.de
|
|
